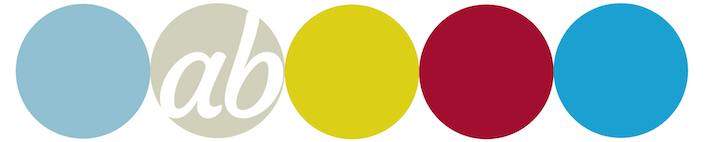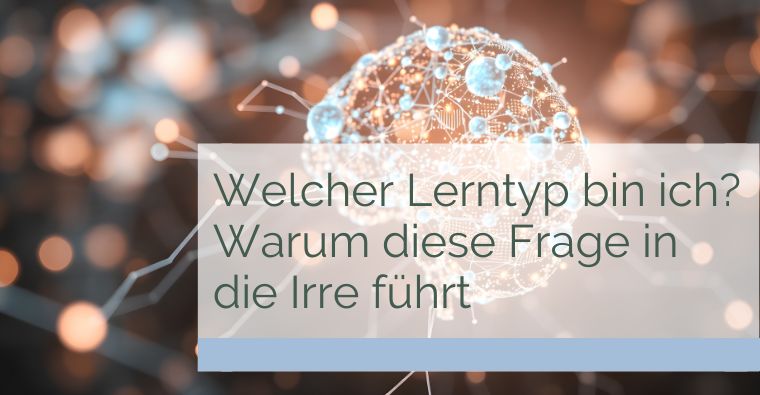Vielleicht hast du es schon einmal ausprobiert: einen sogenannten Lerntypentest.
Ein paar Fragen, ein paar bunte Balken – und am Ende steht fest: Du bist der visuelle Lerntyp. Ab jetzt sollst du alles mit Farben, Bildern und Mindmaps lernen.
Du markierst, du zeichnest, du strukturierst – und trotzdem bleibt nichts hängen.
Statt Klarheit kommt Frustration.
Der Gedanke, dass man besser lernt, wenn man den eigenen Lerntyp kennt, ist verlockend. Er klingt wissenschaftlich, logisch, fast naturgegeben.
Doch die Idee ist ein Mythos. Das Konzept der Lerntypen beruht auf vereinfachten Annahmen, die längst widerlegt sind – und die mehr Schaden anrichten, als sie Nutzen bringen.
Zeit, genauer hinzuschauen.
Was ist überhaupt ein „Lerntyp“?
Die Vorstellung, dass Menschen auf eine ganz bestimmte festgelegte Weise „am besten“ lernen, stammt aus den 1970er-Jahren. Besonders populär wurde sie durch den Biochemiker Frederic Vester, der vier grundlegende Lerntypen unterschied:
- den visuellen Typ (lernt durch Sehen),
- den auditiven Typ (lernt durch Hören),
- den haptisch-kinästhetischen Typ (lernt durch Tun und Bewegung)
- und den kommunikativ-intellektuellen Typ (lernt durch Austausch und Nachdenken).
Das klingt zunächst plausibel – schließlich erleben wir ja, dass Menschen unterschiedlich auf Reize reagieren.
Doch genau hier liegt der Denkfehler: Das heißt nicht, dass diese Unterschiede stabile, biologisch festgelegte „Typen“ darstellen.
Zahlreiche Studien zeigen, dass die Anpassung von Unterricht oder Lernmethoden an angebliche Lerntypen keinen messbaren Vorteil bringt. Das Gehirn arbeitet grundsätzlich multimodal – also immer über mehrere Sinneskanäle gleichzeitig. Wer Informationen sieht, hört, bewegt und emotional erlebt, speichert sie deutlich stabiler als jemand, der sich auf einen Kanal beschränkt.
Die Typenlehre – ein veraltetes Menschenbild
Die Einteilung in Typen ist kein neues Phänomen. Schon in der Antike versuchten Gelehrte, Menschen in Kategorien zu sortieren. Hippokrates unterschied zwischen Sanguinikern, Melancholikern, Cholerikern und Phlegmatikern.
Seither wuchern unzählige Varianten dieser Typenlehre: Farbtypen, Charaktertypen, Persönlichkeitstests, Kommunikationsstile – und eben auch Lerntypen.
Sie alle folgen demselben Muster: dem Versuch, komplexe menschliche Phänomene in einfache, stabile Schubladen zu pressen.
Das Problem daran: Menschen sind keine statischen Wesen.
Psychologische Forschung zeigt, dass Eigenschaften nicht dichotom sind („entweder–oder“), sondern kontinuierlich verteilt.
Unsere Wahrnehmung, unser Verhalten, unsere Lernfähigkeit – all das verändert sich zudem auch ständig mit Kontext, Stimmung, Energie und sozialer Sicherheit.
Typenmodelle wirken auf den ersten Blick hilfreich, weil sie Orientierung geben.
Sie sind einfach, eingängig und vermitteln das Gefühl, sich selbst besser zu verstehen. Doch sie tun das, indem sie reduzieren.
Sie machen aus lebendigen, anpassungsfähigen Menschen eine Art Schaltplan: Du bist so, ich bin so, fertig.
Und genau diese Reduktion ist gefährlich.
Denn wer sich einmal als „visueller Typ“, „Gefühlsmensch“ oder „Analytiker“ identifiziert hat, neigt dazu, alles andere auszublenden – und damit Entwicklung zu verhindern.
Lernen dann Menschen alle gleich?
Dass die Typenlehre wissenschaftlich nicht haltbar ist, bedeutet nicht, dass alle Menschen gleich lernen.
Natürlich gibt es Unterschiede – in Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Motivation, Bedürfnis nach Struktur oder Reizintensität. Nur sind diese Unterschiede nicht festgelegt, sondern situations- und kontextabhängig.
Lernen ist kein festes Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren:
- der jeweiligen Aufgabe,
- der inneren Verfassung,
- der Umgebung,
- der Beziehung zum Lernstoff,
- und den Erfahrungen, die jemand mit bestimmten Lernformen gemacht hat.
Im Laufe des Lebens bilden sich daraus Lernstile, also wiederkehrende Muster und Vorlieben im Umgang mit Wissen.
Sie entstehen durch Gewöhnung, durch Erfolgserlebnisse, manchmal auch durch Misserfolge. Wer jahrelang mit Karteikarten gelernt hat, greift später automatisch wieder zu ihnen – nicht, weil das „der Typ“ ist, sondern weil es vertraut ist.
Lernstile sind also erworben, veränderlich und flexibel – und sie dürfen es auch sein.
Typenmodelle verkennen genau diese Dynamik. Sie tun so, als ließen sich Menschen in stabile Kategorien einordnen, obwohl das Lernen in Wirklichkeit ein sich ständig veränderndes System ist: beeinflusst durch Emotionen, Aufmerksamkeit, Energie, Sinn und Beziehung.
Mit anderen Worten: Menschen lernen unterschiedlich, aber nicht typologisch.
Sie lernen situativ – als Antwort auf das, was das Leben gerade verlangt.
Warum das Festhalten an Typen gefährlich ist
Typenlehre wirkt harmlos, ist aber trügerisch in ihrer Einfachheit.
Sie vermittelt Orientierung, wo in Wahrheit Unsicherheit herrscht. Doch sie führt oft dazu, dass Menschen sich selbst unterschätzen oder festlegen.
- Sie verhindert Entwicklung. Wer glaubt, nur visuell lernen zu können, probiert andere Wege gar nicht erst aus. So bleibt Lernen starr statt lebendig.
- Sie erzeugt falsche Erwartungen. Wenn der „passende“ Lernstil nicht funktioniert, entsteht Frustration – als wäre man selbst das Problem.
- Sie verkennt die Rolle von Kontext und Emotion. Lernen ist immer ein Beziehungsprozess: zwischen Mensch, Stoff, Umgebung und Bedeutung. Kein Test kann das abbilden.
- Sie blendet neurodiverse Realität aus. Menschen mit ADHS, Autismus oder Hochbegabung haben Wahrnehmungsprofile, die noch wenige in diesenTypen abgedeckt werden. Für sie sind Typenmodelle nicht nur nutzlos, sondern oft sehr frustrierend.
Was stattdessen hilft
Wenn man Lernen als dynamisches System versteht, ergeben sich ganz andere Fragen:
Wie kann ich meine Aufmerksamkeit steuern? Welche Bedingungen brauche ich, um konzentriert zu sein? Was hilft mir, Inhalte zu verankern?
Hier einige Grundprinzipien, die nachweislich wirken – unabhängig von Typen:
- Multimodales Lernen
Je vielfältiger die Zugänge, desto stabiler das Wissen.
Wer Inhalte liest, hört, diskutiert und anwendet, schafft mehr neuronale Verbindungen – und damit mehr Haltbarkeit. - Bedeutung und Sinn
Informationen bleiben nur dann im Gedächtnis, wenn sie Bedeutung haben.
Frage dich: Warum ist das wichtig für mich? – dein Gehirn speichert Sinn, nicht Fakten. - Emotion und Sicherheit
Emotionen öffnen oder blockieren den Zugang zum Lernen.
Ein sicherer, wertschätzender Rahmen aktiviert Neugier; Angst lähmt. - Bewegung und Körper
Lernen ist ein körperlicher Vorgang.
Bewegung, Gestik oder sogar das Stehen beim Lernen fördern Aufmerksamkeit und Gedächtnisbildung. - Selbstbeobachtung
Die wichtigste Fähigkeit ist, das eigene Lernen wahrzunehmen:
Was funktioniert heute – und warum?
So entsteht ein persönliches, variables Lernprofil, das auf Erfahrung statt auf Etiketten basiert.
Wie du dein Lernen gezielt gestalten kannst
Variiere bewusst.
Kombiniere Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen, Tun.
Jeder Kanal bietet andere Zugänge und Verknüpfungen.
Wechsle den Kontext.
Manche Themen lernst du besser am Schreibtisch, andere beim Gehen oder im Gespräch.
Das Gehirn liebt neue Umgebungen – sie aktivieren zusätzliche Netzwerke.
Plane Pausen ein.
Lernen braucht Zeit, um sich zu festigen.
Regelmäßige Unterbrechungen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil des Prozesses.
Beobachte dich langfristig.
Welche Umstände helfen dir wirklich? Welche hemmen dich?
Wer das weiß, braucht keine Typentests mehr – er / sie versteht sich selbst.
Fazit
Die Frage „Welcher Lerntyp bin ich?“ klingt nach Erkenntnis, führt aber in die Vereinfachung.
Sie entstammt einem Denken, das Menschen auf stabile Muster reduzieren will, wo in Wahrheit Bewegung und Vielfalt herrschen.
Lernen ist kein fester Charakterzug, sondern eine Form der Beziehung – zwischen dir und dem, was du begreifen willst.
Es verändert sich mit deiner Lebenssituation, deinem Körper, deiner Stimmung und deiner Erfahrung.
Das ist kein Mangel an Struktur, sondern Ausdruck von Lebendigkeit.
Du bist kein Lerntyp.
Du bist jemand, der lernt – wandelbar, komplex und einzigartig.
Und genau darin liegt deine Stärke.
Foto von berkay08 über Canva.com